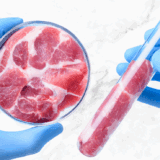Bewusster Konsum: Wie Kaufentscheidungen die Gesellschaft prägen
Die Studie „Politischer Konsum im Alltag“ der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf zeigt, dass politisch motiviertes Konsumverhalten in Deutschland 2025 weit verbreitet ist – besonders im Bereich Lebensmittel und Getränke. In diesem Beitrag erfahrt ihr mehr über die Hintergründe und wie Food-Startups von dem Trend profitieren können.
Warum Menschen politisch konsumieren
Die aktuelle Befragung der Studie „Politischer Konsum im Alltag“ zeigt, dass viele Menschen den Kauf von Lebensmitteln nicht mehr als bloßen Akt der Versorgung betrachten, sondern als Ausdruck ihrer Haltung. Knapp ein Drittel der Befragten misst der tierleidfreien Produktion, Umweltfreundlichkeit und fairen Arbeitsbedingungen bei der Herstellung von Produkten große Bedeutung bei. Diese Kriterien treten zunehmend an die Stelle klassischer Kaufmotive wie „niedriger Preis“ oder „Marke“. Zwar ist für die Mehrheit nach wie vor die gesundheitliche Unbedenklichkeit wichtig (56 %), doch bei der Bewertung von Lebensmitteln wächst der Anspruch an ethische und ökologische Standards stetig.
Im Jahr 2025 geben 62 % der Befragten an, in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal Produkte oder Dienstleistungen aus politischen, ethischen oder ökologischen Gründen boykottiert zu haben. 43 % haben im selben Zeitraum Produkte gezielt aus solchen Gründen gekauft – also „buykottiert“. Auffällig ist, dass rund zwei Drittel (66 %) der politisch Konsumierenden angaben, beim Kauf von Lebensmitteln und Getränken (fast) immer politische oder ethische Aspekte zu berücksichtigen. Damit ist dieser Bereich der häufigste Ort für politisch motivierte Konsumentscheidungen.
Unterstützung durch gezielten Einkauf

Beim sogenannten Buykott steht die bewusste Unterstützung ausgewählter Angebote im Vordergrund. Dabei richtet sich der Fokus weniger auf einzelne Marken, sondern vorrangig auf Produkteigenschaften, die gezielt gefördert werden sollen. Im Lebensmittelbereich bilden insbesondere eine biologische Produktion, regionale Herkunft sowie eine ökologische Herstellung zentrale Kaufmotive – jeweils mit einem Anteil von 19 % unter den befragten Buykottierenden.
Faire Arbeitsbedingungen wurden von 17 %, Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit von jeweils 13 % als maßgebliche Gründe für den Kauf bestimmter Produkte genannt. Konsumentinnen und Konsumenten mit politischer Motivation bevorzugen dabei Einkaufsorte, die solche Kriterien unterstützen. Genannt werden unter anderem Hofläden, Bioläden wie Alnatura, Drogeriemärkte wie dm sowie Anbieter, die über zertifizierte Siegel wie Fairtrade, demeter oder GEPA verfügen. Auch Transparenz in Bezug auf Herkunft und Lieferwege wird geschätzt – etwa durch den Einkauf auf Wochenmärkten oder über Direktvermarktungsmodelle, die auf kurze Lieferketten setzen und den unmittelbaren Kontakt zu Produzentinnen und Produzenten ermöglichen.
Handeln im Einklang mit dem Gewissen
Zentrale Beweggründe für politisch motiviertes Einkaufsverhalten liegen laut der Befragung vor allem im individuellen Werteverständnis der Konsumentinnen und Konsumenten. So geben 41 % an, im Einklang mit dem eigenen Gewissen handeln zu wollen. Für 29 % steht im Vordergrund, Unternehmen zu einem verantwortungsvolleren Handeln zu bewegen. Weitere 23 % verfolgen mit ihren Konsumentscheidungen das Ziel, politische Veränderungen mit anzustoßen. Politischer Konsum wird damit nicht nur als Ausdruck persönlicher Überzeugungen verstanden, sondern auch als niedrigschwellige Form gesellschaftlicher Teilhabe – eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, ohne formale Wege wie Parteimitgliedschaften oder politische Kampagnen durchlaufen zu müssen.
Hürden auf dem Weg zum konsequenten Konsum

Trotz einer grundsätzlich hohen Bereitschaft zu politischem Konsum bestehen verschiedene praktische Hinderungsgründe, die eine konsequente Umsetzung im Alltag erschweren. So geben 47 % der Befragten an, dass sie gern häufiger politische, ethische oder ökologische Aspekte in ihre Kaufentscheidungen einbezogen hätten. Als wesentliche Gründe für das Ausbleiben entsprechender Entscheidungen werden insbesondere fehlende Alternativen im Sortiment mit 48 %, finanzielle Einschränkungen mit 47 % sowie ein Mangel an verlässlichen Informationen über Produkte und deren Herstellungsbedingungen ebenfalls mit 47 % genannt.
Darüber hinaus spielen auch eingefahrene Konsumgewohnheiten für 43 % der Befragten eine Rolle. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass politischer Konsum nicht allein auf individueller Ebene ansetzt, sondern auch von geeigneten strukturellen Rahmenbedingungen abhängig ist, primär von einem transparenten Informationsangebot, einem ausreichenden Produktspektrum und finanzieller Zugänglichkeit.
Chancen für Food-Startups
Der Trend zum politischen Konsum bietet Food-Startups die Möglichkeit, sich durch Nachhaltigkeit, Transparenz und faire Produktionsbedingungen klar von Massenanbietern zu differenzieren und eine werteorientierte Kundengruppe anzusprechen. Kleinere Unternehmen können häufig schneller auf veränderte Anforderungen reagieren, etwa durch kurze Lieferketten, Kooperationen mit regionalen Produzentinnen und Produzenten oder innovative Verpackungskonzepte. Die Studie zeigt, dass Konsumentinnen und Konsumenten bereit sind, für Produkte mit nachvollziehbarer Herkunft, transparenter Produktionsweise und klaren ethischen Standards einen höheren Preis zu zahlen. Politischer Konsum ist damit sowohl ein ethischer als auch ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor für junge Lebensmittelunternehmen.
Bildmaterial: Pexels und Canva